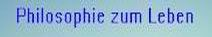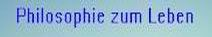|
|
Vom Staunen und von der größeren Freiheit
Inhalt dieser Seite:
1. Hinführung zum Phänomen des Staunens
(Sokrates, Aristoteles, Japsers)
2. Stoische Notwendigkeit
3. Epikureischer Zufall
4. Zu größerer Freiheit
5. Weisheit in der psychologischen Forschung
_______________________________
1. Das Phänomen des Staunens
Die abendländische Philosophie hat ihren Ursprung im alten Griechenland. Eine richtungsweisende Gestalt dieser Philosophie ist Sokrates. Von ihm ist uns der Satz "Ich weiß, dass ich nichts weiß" bekannt. Sokrates betonte immer wieder, dass er den anderen eigentlich nichts beibringen könne, dass die anderen die Wahrheit selbst entdecken müssten. Wie Inspektor Colombo - der Vergleich stammt von Kay Hoffman 84 - stellt er sich unwissend und gibt vor, von seinen Gesprächspartnern lernen zu wollen. Seine Fragen werden dann immer bohrender und am Ende konfrontiert er sie mit ihren eigenen Widersprüchen.
Der Philosoph weiß nichts - so Platon im Symposion -, ist sich aber seines Nichtwissens bewusst (PH 42). Die Unverständigen hingegen sind sich ihrer Unwissenheit nicht bewusst (vgl. die thrakische Magd und Thales!), er ist der Nicht-Weise (PH 66): Der Philosoph also steht zwischen dem Weisen und dem Nichtweisen. Philosophie ist demnach nicht Weisheit, sondern Liebe zu Weisheit und Streben nach Weisheit, eben philo-sophia.
Sokrates weiß, dass er nichts weiß, vor allem weiß er, dass er über den Tod nichts weiß, dagegen behauptet er, über ein anderes Thema durchaus etwas zu wissen:
"Gesetzwidrig zu handeln aber und dem Besseren, Gott oder Mensch, ungehorsam zu sein, davon weiß ich, dass es übel und schädlich ist." (PH 51) Sokrates kennt den Wert der moralischen Handlung und der moralischen Absicht. Diese Wissen schöpft er aus seiner inneren Erfahrung, aus der Erfahrung einer Wahl, die seine ganze Person mit einschließt. Zentrum dieser Innerlichkeit ist das daimonion, jene innerliche Stimme, die ihn davon abhält bestimmte Dinge zu tun. Offensichtlich eine Art mystische Erfahrung, von der noch zu sprechen sein wird.
Das Staunen gilt seit Aristoteles als Anfang der Philosophie. Kinder können staunen und verlernen es häufig durch Genauwissen und Besserwissen. Kay Hoffman (9) berichtet von ihrer kleinen Nichte, die eines Tages fragt, woher die Welt und alles, was auf ihr ist, komme. Ihre größere Schwester antwortete kurzerhand, das habe alles Gott gemacht. Und damit war es mit dem Staunen vorbei.
Kay Hoffman versucht durch das Buch, das sie schreibt, selbst zu ihrem ursprünglichen Staunen zurückzugelangen, und auch den Leser dahin zu führen. Sie empfindet Staunen als einen körperlichen Zustand (11), Staunen sei ein Erwachen aus dem hypnotischen Effekt, den die Gewohnheit auf uns ausübt. Philosophieren macht wach (12). Philosophieren kann ein Mittel zu Lebensorganisation und mehr noch zur Lebensbewältigung sein. Und doch hat mich - so Kay Hoffman (13)- das Philosophieren dort am meisten gereizt, wo die Haltung zusammenbricht und das Wissen, das auf Bewältigung aus ist, nicht mehr weiter weiß. Und dies ist der Moment des Staunens. Philosophie birgt die Chance und die Erlaubnis, sich im Nichtwissen zu beheimaten und vor dort ausgehend unterwegs zu sein. Sich zu erlauben, von Bildern und Eindrücken überwältigt zu werden, statt alles im Griff zu behalten.
Karl Jaspers geht in seinem Buch "Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung" von dem mittelalterlichen Sinnspruch aus (29):
Ich komme, ich weiß nicht woher,
Ich bin, ich weiß nicht wer,
Ich sterb, ich weiß nicht wann,
Ich geh, ich weiß nicht wohin,
Mich wundert's, dass ich fröhlich bin.
Jaspers weist darauf hin, dass dieser Spruch nicht christlich sei, denn im christlichen Glauben gibt auf all diese Frage entsprechende Antworten. Es wird hier durch vorschnelle Antworten aus dem Glaubenswissen der Horizont verstellt. Und diese Offenheit führt zu einem verwunderten Staunen.
Versuchen wir nun selbst einmal auf diesen Weg des Staunens zu kommen, so weit es in dieser Situation und quasi auf Kommando möglich ist.
Inger Christensen: Das Mysterium der Realitäten (42):
Staunen: Die Erde, die wir jetzt von außen sehen können. Da hängt sie. Da wohne ich. Der Weltraum mit, unter anderem, der Natur, mit der Gesellschaft, mit den Menschen, mit mir, mit meinen Gefühlen, meiner Arbeit, meiner Sprache.
Der Weltraum - da ist das Staunen. Darüber, dass die Sonne, die sich wie ein donnernder Scheiterhaufen durch Jahrmillionen hindurch selbst zerstört, Leben erschafft.
Da hängt sie, die Erde, von der Sonne beleuchtet. Von weitem so ruhig und schön. Die bekannten Figuren der Kontinente. All das Grüne und das Blau der Meere. Hie und da Schneeschimmer und die dunklere Dichte der Berge, die Verästelungen der Flüsse. Ab und an in Wolkenwirbel gehüllt.
Wir nehmen uns selbst in die Betrachtung dieses Bildes mit: unsere gegenwärtige Lebenssituation, unsere bisherige Lebenszeit und die uns wohl noch bevorstehende Zeit. Wir sehen uns im Kontext unseres Planetens, im Zusammenhang mit den Milliarden von Menschenschicksalen auf der Erde. Wir reisen in die Zeit - unserer eigenes Lebens bleibt uns dabei immer gegenwärtig - und vergegenwärtigen uns die Entstehung und das Vergehen unseres Heimatplanetens. Wir reisen in Raum und Zeit bis zu unserer Galaxie und den vielen Millionen weiterer Galaxien bis zu den Grenzen des Kosmos.
Wir überlassen uns den Gefühlen der Unsicherheit und den Fragen nach dem Woher, dem Wohin und dem Wozu.
|
|
2. Stoische Notwendigkeit
Die Stoa geht davon aus, dass der Logos, ein beseeltes vollkommenes Wesen, eine Art Weltgesetz die Welt leitet und sich um die Menschen kümmert. Ausdruck dessen ist der Gedanke der Vorsehung. (Höffe 65 u. 66)
Und dies ganz im Gegensatz zu Epikur. Für die Stoa ist das Universum ein organisches Ganzes, für Epikur hingegen ein zufälliges Nebeneinander von Elementen (PH 155).
Die Welt selbst ist nach der Stoa eine Art Lebewesen, das mit sich übereinstimmmt. Und jedes einzelne Lebewesen bringt von Anfang an eine gewisse Übereinstimmung mit sich selbst mit. Diese anfängliche Übereinstimmung gilt es nachzuvollziehen und zu entfalten in allen bewussten Aktionen. Dies geschieht mittels der Vernunft. Die menschliche Vernunft gründet in der Vernunft des Ganzen und in der Teilhabe an ihm (PH 154 f.). Der Stoiker nimmt - hier auch im Gegensatz zu Epikur - Teil am gesellschaftlichen und politischen leben. Er handelt immer auch im Dienste der Gemeinschaft (PH 161).
Wie ist innerhalb dieses Ganzen Freiheit möglich? Freiheit ist die Möglichkeit, sich dem Schicksal zu verweigern. "Verlange nicht, dass alles so geschieht, wie du es wünschest, sondern sei zufrieden, dass es so geschieht, wie es geschieht, und du wirst in Ruhe leben." (PH 159)
An einem Gleichnis versuchen Stoiker dies klar zu machen: Wird ein Hund an einen Karren gespannt und folgt diesem, dann fällt sein spontanes Tun mit der Notwendigkeit zusammen. Will er nicht folgen, so wird er doch dazu genötigt. Durch den Widerstand wird der Kummer nur vergrößert. Geduld und Fügsamkeit in das Unvermeidliche sind ein Gebot der Vernunft. (AdBott 133 f.) Die Heftigkeit unseres Sträubens gegen Dinge, die sich nicht unseren Absichten gemäß entwickeln, wird gemildert, wenn wir bedenken, dass auch wir niemals ohne Halsband durchs Leben gehen. Der Weise wird das Notwendige erkennen und ihm sofort folgen, anstatt seine Kräfte im Protest zu verschleißen (AdB 134). Der Weise wird mit Liebe den Ereignissen, die von der dem Kosmos immanenten Vernunft gewollt sind, zustimmen. (PH 163). Auf diese Ereignisse vorbereiten kann man sich durch die praemeditatio, eine geistige Vorübung, in der man sich auf die möglichen Übel gefasst macht.
Der aufmerksame Mensch lebt unaufhörlich in der Gegenwart der dem Kosmos immanenten Allvernunft, sieht alles in der Perspektive dieser Vernunft und stimmt freudig ihrem Willen zu.
|
|
3. Epikureischer Zufall
(AdB 70:) Epikur sah es als Aufgabe der Philosophie an, dem Menschen zu helfen, ihn vor allem von falschen Glücksvorstellungen zu bewahren.
"Wie nämlich die Heilkunst keinen Nutzen hat, wenn sie nicht die Krankheiten aus dem Körper vertreibt, so hat auch die Philosophie keinen Nutzen, wenn sie nicht die Leidenschaft der Seele vertreibt." 69: Kern der epikureischen Philosophie ist die Einsicht, das die Frage "Was macht mich glücklich?" identisch ist mit der Frage "Was macht mich bzw. meine Seele gesund?"
65: "Wer da sagt, die Zeit zum Philosophieren sei noch nicht gekommen oder schon vorübergegangen, gleicht einem Menschen, der behauptet, die Zeit für die Glückseligkeit sei noch nicht das oder schon vorüber."
Zum Glück braucht der Epikureer Freundschaft, Freiheit und Besinnung (72 ff)).
Vom Zusammensein mit Gleichgesinnten hielt Epikur so viel, dass er sogar riet, man möge niemals allein speisen. Wir existieren erst, wenn jemand unsere Existenz wahrnimmt; was wir sagen, hat erst Bedeutung, wenn jemand unsere Worte versteht. Von Freunden umgeben zu sein, heißt also, dass unsere Identität fortwährend bestätigt wird. Dazu kommt die Freiheit von den Zwängen des Alltagslebens und der Politik - und schließlich als Gegenmittel gegen die Besorgnis: die Möglichkeit im Garten nachzudenken, zur Besinnung zu kommen.
Hindernisse auf dem Weg zu einem glücklichen Leben sind vor allem Ängste: die Furcht vor den Göttern und vor dem Tod (PH 143), die Furcht vor übergroßen Schmerzen und die Beeinträchtigung durch unerfüllbare Wünsche (Höffe 58 u. 60). Das Ungewöhnliche, das Unerreichbare und das Unvermeidbare quälen uns. Zur Beseitigung dieser Hindernisse hilft die Einsicht, dass die Götter nichts mit der Hervorbringung des Universums zu tun haben und sich nicht um das Geschick der Welt und der Menschen kümmern (- die Götter erfreuen sich an ihrer eigenen Vollkommenheit und der reinen Lust am Dasein 146) und dass der Tod für uns nichts bedeutet. Das ewige Universum wird durch zufällige Bewegungen und Zusammensetzung von Atomen bestimmt, wobei den Atomen eine Art Spontaneität zugesprochen wird, die in der menschlichen Freiheit eine Entsprechung findet. Beim Tod fällt der Körper auseinander und jegliches Wahrnehmungsvermögen schwindet. "Der Tod (PH 145) betrifft uns überhaupt nicht; wenn wir sind, ist der Tod nicht da¸ wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr."
Horaz sagt im Sinne Epikurs: (PH 151) "Betrachte jeden neuen Tag, der dir heraufdämmert, als sei es dein letzter; beglückend überrasche dich dann jede Stunde, die unverhofft hinzukommt; betrachte sie als einen außerordentlichen Glücksfall". Wenn wir unsere Existenz als baren Zufall begreifen und die Einmaligkeit unseres Daseins begreifen, dann werden wir es als einziges Wunder erleben.
|
|
4. Zu Größere Freiheit
Sokrates verunsichert seine Gesprächspartner, bis sie zugeben müssen, dass sie eigentlich kein sicheres Wissen haben, das die gewohnten Sicherheiten nicht mehr tragen.
Von welchem Punkt aus ist es Sokrates möglich, die gewöhnlichen Sicherheiten aufzugeben und aufzulösen? Es ist wohl die Erfahrung des Daimonions, jener inneren Stimme, die ihm immer sagte, was er nicht tun solle. Sie riet ihm also immer nur von etwas ab; sie riet ihm niemals zu etwas. So sagt er in Platons Apologie: "Mir ist dieses von meiner Kindheit an geschehen, eine Stimme nämlich, welche jedes Mal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun soll, zugeredet aber hat sie mir nie." (KH 83)
Der Bezug zu dieser inneren Instanz ließ ihn völlig frei den Sicherheiten dieser Welt gegenübertreten, ließ sich sogar die Angst vor dem Tode besiegen, gab ihm Sicherheit über den Tod hinaus.
Wir erinnern uns an den mittelalterlichen Sinnspruch, den Karl Jaspers zitiert:
Ich komme, ich weiß nicht woher,
Ich bin, ich weiß nicht wer,
Ich sterb, ich weiß nicht wann,
Ich geh, ich weiß nicht wohin,
Mich wundert's, dass ich fröhlich bin.
Was ist das für eine Fröhlichkeit, die sich einstellt, wenn man den Unsicherheiten unseres Dasein in Auge schaut? Ist es eine Selbsttäuschung? Ist es die Wirkung von Endorphinen, die uns vor Panikreaktionen schützen sollen? Oder ist es die Schau der wahren Wirklichkeit, die sonst von unseren alltäglichen Erfahrungen überdeckt wird?
Sicher ist, dass Sokrates in seiner Strategie der Verunsicherung von dieser seiner inneren Sicherheit aus gedacht und argumentiert hat.
Es geht also in einem ersten Schritt um Loslösung, um das Loslassen der gewohnten Sicherheiten. Es geht darum einzusehen, dass wir in den wesentlichen Fragen nichts wissen und dass wir in einem zweiten Schritt dies akzeptieren und aushalten - ohne in Panik zu geraten, ohne zu verzweifeln und ohne sarkastisch zu werden. Dann kann als Drittes diese innere Gelöstheit und Heiterkeit sich einstellen, die uns von vielen Großen der Menscheitsgeschichte bekannt ist.
Dieses Grundmuster lässt sich auch bei Epikur feststellen:
Epikur rät seinen Anhängern, die Blickrichtung zu ändern. Sie sollen nicht das Unvermeidliche fixieren, nicht auf das Unerreichbare zu starren, sondern sie sollen den Augenblick nutzen mit den positiven Möglichkeiten - und seien diese auch noch so gering. Und wenn sich der Gegenwart keine positiven Aspekte abringen lassen, so bleiben immer noch die Erinnerungen an solche in der Vergangenheit oder die Aussicht auf solche in der Zukunft.
Epikur lebt uns vor, dass es möglich ist, sich den Unsicherheiten und den begrenzten Möglichkeiten unseres Daseins auszusetzen, sich mit ihnen sozusagen anzufreunden - und dabei dennoch nicht die innere Gelassenheit und Heiterkeit zu verlieren.
Phase eins: Man muss die herkömmliche Weltsicht, die von Sorgen, Plänen und Ängsten bestimmt ist, hinter sich lassen.
Phase zwei: Der Mensch muss es aushalten, dass die Welt und das menschliche Dasein unkalkulierbaren Zufällen ausgesetzt ist. Diese Einsicht befreit den Menschen zugleich von Ängsten und Sorgen. Der Mensch reduziert seine Bedürfnisse auf ein natürliches Maß. Und diesen Minimalstandard zu wahren, fällt für gewöhnlich leicht.
Phase drei: Und nun kann sich wieder jene innere Erfahrung einstellen, jene freundliche Heiterkeit, die man Epikur nachsagte, jene innere Haltung, die man an ihm bewunderte, jene sonderbare Überlegenheit, die so viele Menschen faszinierte.
Auch in der Stoa, obwohl der philosophische Ansatz ganz im Widerspruch zum epikureischen Denken steht, lässt dieses Dreiphasenmodell entdecken.
Erstens: Die Distanz zur gewöhnlichen Weltsicht stellt sich ein, wenn man bereit ist, in allem, was ist und geschieht, den Logos, die Weltvernunft am Werke zu sehen - bei Epikur die Planlosigkeit - hier die planende Vorsehung. Dabei muss man sich lösen von den eigenen Planungen und Erwartungen und - zweitens - sich ganz den Wechselfällen des Schicksals, die aber aus höherer Sicht ein äußerst sinnvolles System bilden, anvertrauen.
So kann es - drittens - zu einem tiefen Einverständis mit den Gesetzen des Universums kommen und zu jener heiteren Gelassenheit des Weisen.
Gemeinsamkeit:
- Distanz zu sich und zu den planbaren Zielen - Loslösung - sich einer größeren Wirklichkeit anvertrauen
- Das vom Ich bestimmte Lebenskonzept löst sich auf, bzw. fügt sich ein in ein umfassenderes Konzept
|
|
5. Weisheit in der psychologischen Forschung
Auch in der psychologischen Forschung finden sich Konturen dieser "Weisheit":
("Psych.heute" 10/2001, S. 21 ff.: Kriterien für Weisheit nach Paul Baltes und Ursula Staudinger)
Weise Menschen sind ausgeglichen, sie sind weder euphorisch noch griesgrämig. Ihr subjektives Wohlbefinden bewegt sich auf einer Skala von null bis zehn zwischen den Werten sechs und sieben (24).
Weise Menschen besitzen ein umfangreiches Faktenwissen, verfügen über Strategiewissen, berücksichtigen den Kontext einer Lebensphase, sind tolerant und akzeptieren einen gewissen Pluralismus und sie erkennen die Ungewissheit und Unsicherheit, die dem Leben innewohnt. S. 25: Die weise Person erträgt die permanente Ungewissheit und Unsicherheit des Lebens.
Wir erkennen in dieser Beschreibung unser Grundmuster wieder: Die größere Distanz zu den Gegebenheiten unseres Lebens und dieser Welt, der weitere Kontext, den der Weise sucht, und schließlich die Bereitschaft, angesichts der Unsicherheiten unseres Dasein auch Lösungen zu akzeptieren, die unseren Bestrebungen völlig zuwiderlaufen.
Dazu im Vergleich das Ideal des antiken Weisen:
Das Bild des Weisen der psychologischen Forschung ergibt in der Auswertung von Befragungen und Einschätzungen, wobei der Konsens über das, was einen Weisen auszeichnet, sehr hoch sein soll.
Die Gestalt des antiken Weisen ist ein Ideal, dessen Realisierung man eigentlich nicht so recht erwartet. Nur alle 500 Jahre - so eine Äußerung von Stoikern - trete ein Weiser auf. Dennoch ist eine Ähnlichkeit zwischen diesem hohen Ideal und dem durch psychologische Erhebung ermittelten Weisen unverkennbar.
Nun einige Merkmale dieses Weisen nach PH:
Der Weise ist mit sich selber identisch in vollkommener seelischer Ausgeglichenheit, d.h. er ist glücklich, unter welchen Umständen auch immer (256). Der Weise ist unabhängig von den Umständen und von den äußeren Dingen. Die äußeren Dinge beunruhigen ihn nicht, weil weil der sie weder als gut noch als schlecht ansieht. Sie sind für ihn gleichgültig (257).
Man wird nicht Schritt für Schritt weise, sondern durch augenblickliche Transformation, durch eine abrupte, tiefgreifende Verwandlung (260).
Die Ähnlichkeit mit dem Einsetzen der Erleuchtung in der buddhistischen Tradition ist offensichtlich.
|
|
|
|